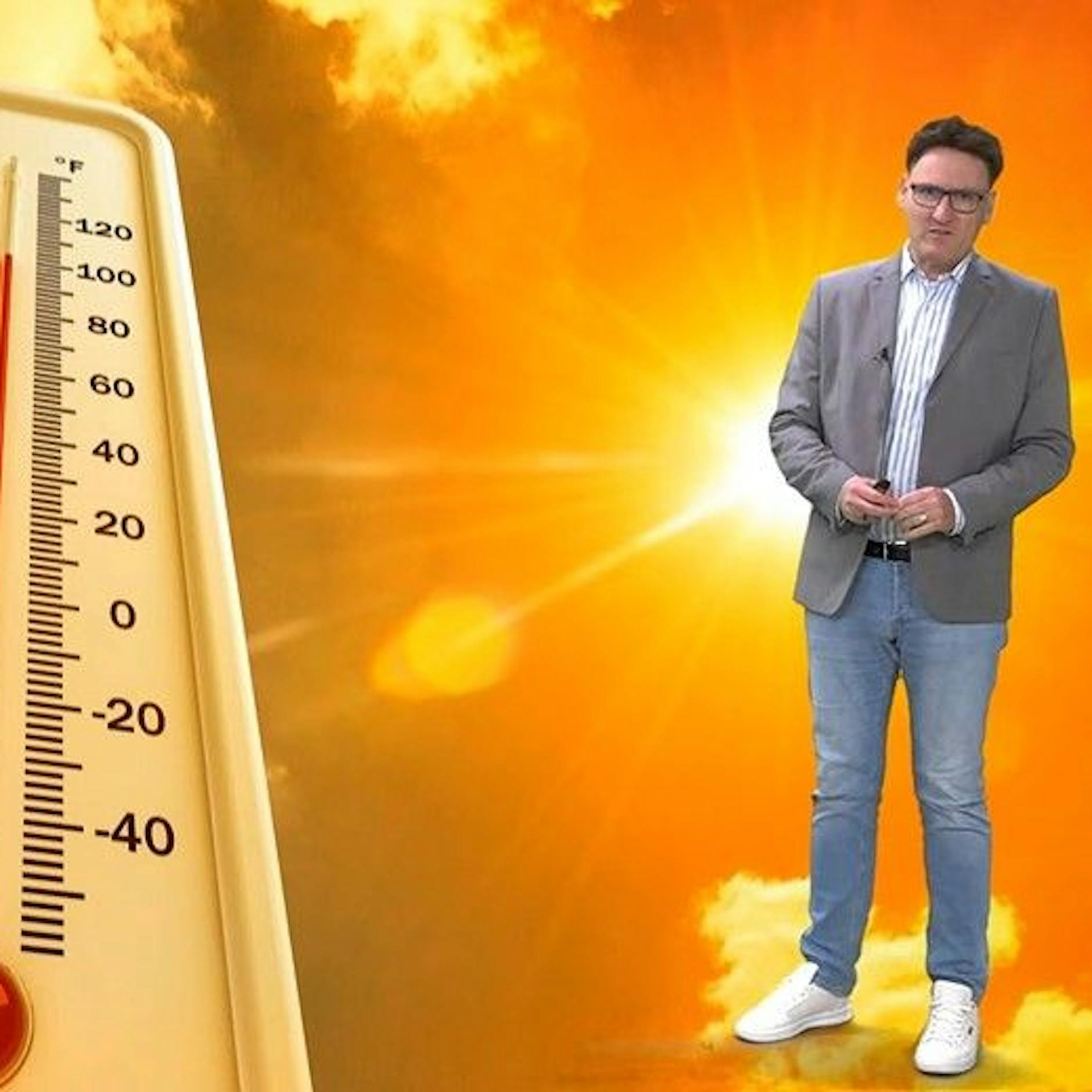Die Notfallrettung in Berlin steht kurz vor dem Kollaps. Immer mehr Einsätze, immer weniger Spielraum – das System funkt SOS, und alle fragen sich: Muss erst jemand sterben, damit Berlin reagiert?
Seit 2008 haben sich die Rettungsdiensteinsätze der Berliner Feuerwehr um mehr als 60 Prozent erhöht – ein Anstieg, der in keinem Verhältnis zur Anzahl der Notrufe steht. Die sind nämlich seitdem fast unverändert geblieben.
Während 2008 noch rund 1,1 Millionen Notrufe zu knapp 328.000 Rettungseinsätzen führten, löste fast dieselbe Anzahl an Notrufen im Jahr 2021 mehr als 492.000 Einsätze aus. Das bedeutet: Immer mehr Anrufe führen zu einem Einsatz – ein Trend, der spätestens 2022 auch dem Landesrechnungshof auffiel. Dessen Analyse stellte klar: Der massive Anstieg lässt sich weder durch Bevölkerungswachstum noch durch demografische Entwicklungen erklären.
Rettungseinsätze: Belastung hat ein kritisches Niveau erreicht
Im Rettungsalltag macht sich der Druck längst bemerkbar, schreibt die Berliner Zeitung in ihrem Bericht dazu. Bereits in den ersten Monaten dieses Jahres wurden monatlich bis zu 44.000 Einsätze registriert – noch vor dem Sommer, der erfahrungsgemäß eine weitere Steigerung bringt.
Für die Feuerwehrleute ist klar: Die Belastung hat ein kritisches Niveau erreicht. Ihr Anliegen ist deutlich – die Feuerwehr solle sich wieder auf ihre Kernaufgaben konzentrieren, statt als Ersatz für Hausärzte und allgemeine Gesundheitsversorgung herzuhalten.
Mit einem Appell ging neulich der Verein BerlinBrennt, ein Zusammenschluss von Feuerwehrleuten, an die Öffentlichkeit: „Spröde Lippen, ausgerissenes Kopfhaar, der eingerissene Fingernagel oder ganz allgemein die hausärztliche Versorgung der Berliner Bevölkerung zählen nicht zu den Kernaufgaben des Rettungsdienstes“, heißt es in seiner Erklärung.
Einsatzzahlen der Notfallretter in Berlin explodieren
Ein zentraler Auslöser für die Explosion der Einsatzzahlen wird in einem unscheinbaren, aber mächtigen Instrument vermutet: dem Abfrageprotokoll SNAP. Seit seiner Einführung ist es die Grundlage jeder Notrufbearbeitung in Berlin. Es soll standardisiert, transparent und vor allem rechtssicher klären, welche Art von Hilfe notwendig ist. In der Praxis führt SNAP aber häufig dazu, dass Rettungswagen oder sogar Notärzte zu Bagatellen geschickt werden – etwa bei leichten Erkältungen oder Hautabschürfungen.
Das Ziel, durch das System überflüssige Einsätze zu vermeiden und Ressourcen zu sparen, wurde verfehlt, berichtet die Berliner Zeitung. Stattdessen hat sich die Zahl der Rettungseinsätze massiv erhöht. Früher entschieden erfahrene Disponenten frei, ob ein Notruf einen Rettungseinsatz erforderte. Heute sind sie an ein festes Protokoll gebunden, das kaum Raum für Einschätzungen lässt. Jede Abweichung müsste akribisch dokumentiert und im Zweifelsfall juristisch verteidigt werden.
Dass das System mit enormen Kosten verbunden ist – etwa eine Million Euro für die Software und jährlich zehntausende Euro für Lizenzen –, macht es zusätzlich brisant. Hinzu kommen technische Probleme und der Umstand, dass das System längst nicht überall im Feuerwehrbetrieb genutzt wird. SNAP wird mittlerweile nur noch im Rettungsdienst eingesetzt, nachdem es sich in anderen Bereichen als unpraktikabel erwiesen hatte.
Selbst kleinere Vorfälle landen bei der Feuerwehr
Feuerwehrleute berichten, dass die Anwendung des Systems so komplex ist, dass es kaum möglich sei, im Stress eines Notrufs alle Vorgaben fehlerfrei umzusetzen. Gleichzeitig führe die starre Struktur dazu, dass praktisch jeder Anruf in einen Einsatz mündet – ein Grund, warum heute aus zehn Notrufen fast ebenso viele Einsätze resultieren, während früher nur ein Bruchteil tatsächlich beschickt wurde.
Trotzdem verteidigen die Behörden das System. Für sie bedeutet SNAP rechtliche Sicherheit – auch wenn es keine Daten darüber gibt, ob die Anzahl der Beschwerden durch die Einführung tatsächlich gesunken ist. Kritiker sprechen von einem System, das Verantwortung delegiert, ohne echte Lösungen zu bieten.
Dabei ist Berlin nicht allein mit dem Problem. In anderen Städten steigen die Einsatzzahlen ebenfalls drastisch – auch dort, wo SNAP gar nicht verwendet wird. Laut dem Verwaltungsfachverband KGSt liegt Berlin sogar unter dem Durchschnitt, was die Alarmierungen pro Rettungswagen betrifft. Doch selbst dieser Vergleich ändert nichts an der Realität auf den Straßen: Es fehlen Einsatzkräfte und Fahrzeuge.
Entlastung für Berliner Retter durch Notfallkategorien
Um zumindest eine erste Entlastung zu schaffen, hat die Feuerwehr im März neue Notfallkategorien eingeführt. Je nach Dringlichkeit soll nun entschieden werden, ob ein Notarzt nötig ist oder ob Rettungssanitäter ausreichen. In den leichtesten Fällen werden Anrufer direkt an die Kassenärztliche Vereinigung weitergeleitet – eine Maßnahme, die bereits erste Wirkung zeigt, aber das Grundproblem nicht löst: die chronische Überlastung.

Kritik am bestehenden System kommt nicht nur von Feuerwehrleuten. Auch innerhalb der Gewerkschaft gibt es Zweifel an SNAP. Es sei zu schwerfällig, zu unflexibel und nicht mehr zeitgemäß. Andere Protokollsysteme, die leichter zu bedienen und schneller in der Anwendung seien, stünden längst zur Verfügung – werden in Berlin aber ignoriert.
Auch ein funktionierendes Zusammenspiel mit anderen Diensten – etwa dem sozialpsychiatrischen Dienst oder privaten Krankentransportfirmen – fehlt bisher weitgehend. Die Folge: Selbst kleinere Vorfälle oder Hilferufe, für die eigentlich kein Rettungswagen erforderlich wäre, landen bei der Feuerwehr.
Die Lage ist angespannt – und das nicht erst seit gestern. Schon 2018 protestierten Feuerwehrleute vor dem Roten Rathaus und wiesen auf die dramatische Entwicklung hin. Die Ursachen wurden seitdem kaum erforscht. Stattdessen hält man an Erklärungen fest, die längst nicht mehr tragen.
Warum fehlt es seit Jahren am Willen, die Probleme an der Wurzel zu packen?