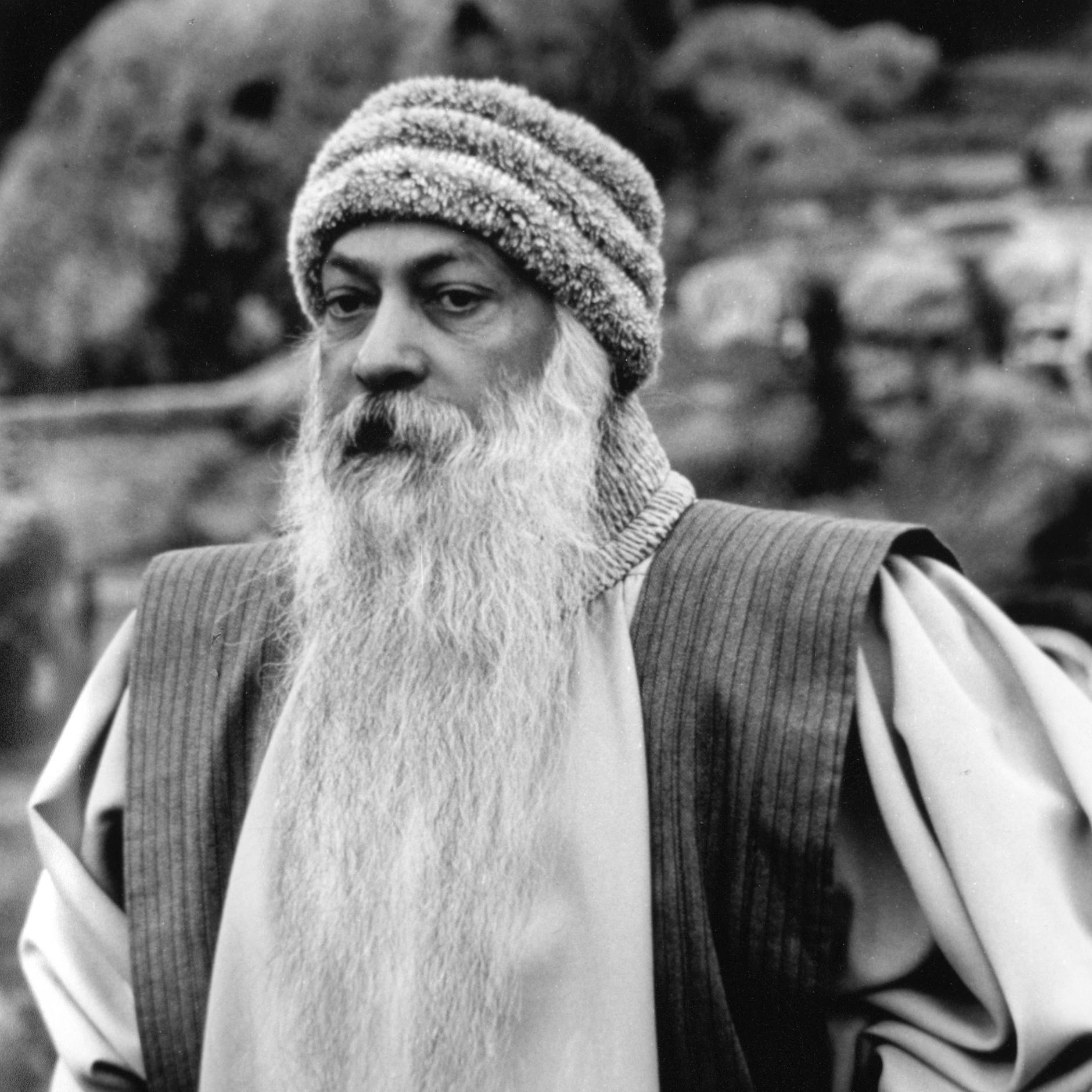Wo waren Sie, als die Mauer fiel? Diese Frage entfacht bei vielen, die in jener historischen Nacht dabei waren, ein wahres Feuerwerk der Gedanken. Man hört Geschichten voller Freude, voller Liebe, voller Glück, aber auch voller Atemlosigkeit. Und manchmal schwingt – je nachdem, mit wem man spricht und wie der Mauerfall sein oder ihr Leben veränderte, auch ein wenig Zorn mit. Ich kann die Frage danach, wo ich war, als die Mauer fiel, sehr klar beantworten: im Bauch meiner Mutter. Ich wurde 1989 gezeugt, meine Eltern sagen immer: während der letzten Etappe der Friedensfahrt. Im Februar 1990 kam ich zur Welt, war acht Monate DDR-Bürger. Bin weder Fisch, noch Fleisch. Bekam nichts mit – und wurde trotzdem geprägt.
Generation Wende: In der DDR geboren, im vereinten Deutschland aufgewachsen
Als der Mauerfall sein 25-jähriges Jubiläum feierte, schrieb ich einen Text für den KURIER. Meine Mutter erzählte mir damals, wie es genau abgelaufen war, als das Bollwerk aus Beton und Stacheldraht nach der friedlichen Revolution in die Binsen ging. Als Schabowski in der legendären Pressekonferenz die Reisefreiheit verkündete, stand sie am Bügelbrett und bügelte schonmal die Babysachen, die meine Eltern für mich besorgt hatten. Am Anfang habe niemand wirklich verstanden und geglaubt, was da passierte. Sie schwankten zwischen Freude und Euphorie auf der einen Seite – und der großen Sorge, dass alles blutig enden könnte, auf der anderen Seite. Nach einem ersten Ausflug meines Vaters mit Bekannten machte sich meine Familie erstmals zwei Wochen nach dem Mauerfall auf den Weg in den Westen.
Sie wollten die fremde Welt erkunden, schwangen sich in den himmelblauen und so herrlich knatternden Trabi. Mein Vater fuhr, meine Oma kam mit, meine Schwester und eine Bekannte. Ich durfte vorn sitzen, auf dem Beifahrersitz – im Bauch meiner Mutter. Viele Geschichten gibt es über jene Zeit. Darüber, dass meine Schwester dort, wo das Begrüßungsgeld ausgeteilt wurde, ein Tütchen Gummibärchen bekam – und als sie verriet, dass sie an dem Tag Geburtstag hatte, bekam sie gleich ein zweites. Darüber, dass mein Vater ein Autoradio kaufen wollte, in einen Laden ging und fragte: „Haben Sie Autoradios?“ Und als der Verkäufer etliche Modelle auf den Tresen gelegt hatte, ging er wieder, weil er nicht wusste, welches er nehmen sollte.
Die wohl schönste Geschichte ist aber die: Beim ersten Ausflug ging es für meine Familie auch ins berühmte KaDeWe. Das Universum, das vor ihnen lag, war aber sehr groß, sagte meine Mutter. „Das nahm mir die Luft.“ Plötzlich wurde ihr schlecht, sie setzte sich auf einen Schaufenster-Vorsprung. Ich hätte, erinnert sie sich, plötzlich wie verrückt gezappelt. Was auch immer draußen los war, dass gerade Weltgeschichte passierte: Ich schien es mitbekommen zu haben.

Die ersten Monate meines Lebens verbrachte ich dann in der DDR – natürlich ohne es zu merken. Noch bevor ich die ersten Schritte machte, war die deutsche Wiedervereinigung durch. Ich war also für etwas mehr als acht Monate DDR-Bürger, nicht mehr und nicht weniger. Geboren in einem Land, das kurz danach nicht mehr existierte, aufgewachsen im vereinten Deutschland. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Es ist ein komisches Gefühl, das ich in Bezug auf die DDR habe. Wenn ich daran denke, dass ich zwischen den Stühlen stehe, fühle ich Glück, aber auch Unglück.
Seit mehr als zehn Jahren arbeite ich für den KURIER. In dieser tollen Stadt kommt man um das Mauerfall-Thema nicht herum. Ich lernte Menschen kennen, Interviewpartner und Kollegen, die erzählten, was 1989 hier los war. Die berichteten, wie atemlos sie für den Beruf mit der Kamera um den Hals und dem Schreibblock in der Hand durch die Stadt hetzten, wie sie nicht nur Geschichten schrieben, sondern selbst ein Teil davon wurden. Und wie der Mauerfall das Leben jedes einzelnen beeinflusste. Nicht nur im beruflichen Bereich, auch im privaten.
Ein Kollege erzählte mir, wie euphorisch das Leben damals verlaufen sei. Nach all den Jahren durfte man endlich seine Meinung sagen! Durfte handeln, ohne Repressalien zu fürchten! Durfte Dinge in Angriff nehmen! Seine Träume umsetzen! Am Telefon sprudelt es aus ihm heraus. Die Welt habe offen gestanden, sagt er – und das sei die schönste Zeit gewesen. Es ist ein Gefühl, das ich nur aus Erzählungen kenne und aus Filmen wie „Goodbye Lenin“. Und das in mir etwas ganz Seltsames hervorruft: Neid. Ich bin neidisch, dass ich damals nicht dabei war. Dass ich zu spät kam, um mit anderen Geschichte zu schreiben. Dass ich niemals werde fühlen können, was die Menschen damals gefühlt haben müssen. Was meinen Kollegen wie eine Welle durchflutet, wenn er darüber spricht. In diesem Moment spüre ich das Unglück darüber, manche Dinge nicht erlebt zu haben.
Doch es gibt auch: das Glück, manche Dinge eben nicht erlebt zu haben. Denn damit sich die Welt plötzlich unglaublich weit und frei anfühlen kann, muss sie vorher sehr eng und abgegrenzt sein. Die Angst vor Repressalien, die Mauern, die Bespitzelung durch die Stasi, der Apparat des SED-Regimes, die Mangelwirtschaft im Sozialismus: All diese Dinge habe ich nie erlebt, werde auch in diesem Bereich niemals fühlen können, was andere fühlen. Und kann dafür, das ist mir bewusst, ziemlich dankbar sein. Für mich ist es ein großes Glück, dass es nur gute Dinge von damals in mein Leben geschafft haben.
Erinnerungen an die DDR sind ein Teil meines Lebens geworden – und geblieben
Die DDR ist nämlich trotzdem ein Teil meines Lebens geworden und geblieben. Kleinigkeiten sind es, die mich noch heute begleiten und die, obwohl ich all das knapp verpasst habe, ein Stück meiner Identität geworden sind. Erinnerungen, Rituale, geliebte Dinge. Vielleicht liegt es daran, dass der Westen länger brauchte, um es in den letzten Winkel der sächsischen Provinz zu schaffen. Oder daran, dass feste Dorf-Strukturen etwas robuster gegen zu überstürzten Fortschritt sind. Vielleicht aber auch daran, dass in meiner Familie nicht, wie es anderswo üblich war, alles Alte aus dem Fenster geschmissen wurde, um Platz für die tollen, neuen Dinge aus dem Westen zu schaffen. Als mir mal einer der Macher des Berliner DDR-Museums erzählte, dass zur Wende einfach nur aus Prinzip vieles entsorgt wurde, weil man sich befreien wollte von altem Ballast aus der DDR-Zeit, kann ich das verstehen. Doch es gibt einen Teil in mir, der es auch ganz schön schade findet.

Wie gern würde ich unseren himmelblauen Trabi noch einmal knattern hören
Wir hatten unseren himmelblauen Trabi etwa noch recht lange: Mein Vater fuhr mich damit in den Kindergarten und drehte den Zündschlüssel nur, wenn ich „Trabi, bitte los!“ gerufen hatte. Heute denke ich manchmal: Wie schön es doch wäre, ihn nochmal knattern zu hören. In meiner Kindheit guckte ich „Spuk im Hochhaus“ und „Das Zaubermännchen“. Mein Lieblings-Hörspiel war „Das Katzenhaus“, und auch heute lege ich die Schallplatte gern auf den alten Plattenspieler meiner Oma und lausche dem sachten Knistern, auch wenn die alte Nadel des „Ziphona Türkis“ schon etwas krumm ist. Der „Traumzauberbaum“ und „Mimmelitt, das Stadtkaninchen“ dudelten im Kindergarten rauf und runter – und irgendwann, als Reporter in Berlin, mal Monika Erhardt-Lakomy zu treffen, war wundervoll. Ich liebte das orangefarbene Rührgerät RG28, das meine Oma bis zu ihrem Umzug ins Pflegeheim hatte, und ärgere mich heute, dass wir es weggeworfen haben. Und ich packe noch heute jedes Jahr die erzgebirgischen Nussknacker und Räuchermännchen aus, manche haben am Fuß noch das EVP-Schildchen.
Es sind solche schönen Dinge aus der Zeit vor der Wende, die es in mein Leben schafften – und bis heute dort blieben. Und die ich weiter erhalten werde, genau wie meine gemischten Gefühle zum Mauerfall. Denn zu Glück und Unglück gesellt sich jedes Jahr, wenn sich das Jubiläum jährt: Dankbarkeit. Zum 25-Jahre-Jubiläum gab es in Berlin die „Lichtgrenze“ – erinnern Sie sich? Eine Lampen-Installation, die den Verlauf der Mauer nachzeichnete. Leuchtende Ballons, die zum Höhepunkt der Feierlichkeit in den Himmel stiegen.