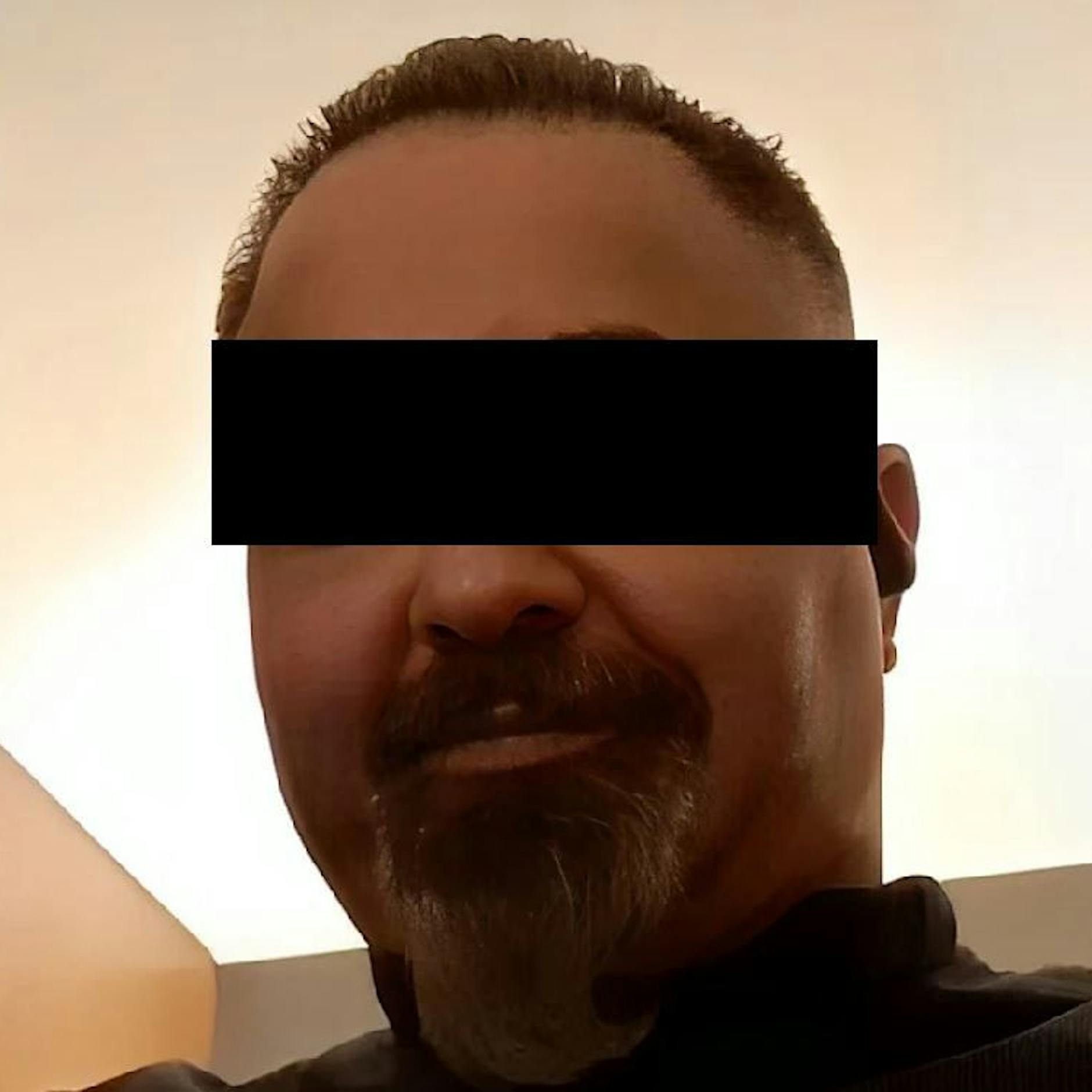Vor einigen Jahren führte der Todesfahrer von Magdeburg ein Interview mit der FAZ. Hier eine Zusammenfassung dieses bemerkenswerten Gesprächs, das tief blicken lässt und viel über die möglichen Motive des Mannes aussagt.
Das Interview mit Taleb A., das im Juni 2019 erschien, gewährt Einblicke in seine Gedanken und seinen Lebensweg. Einträge des mutmaßlichen Attentäters in sozialen Medien deuten darauf hin, dass dieser in den darauffolgenden fünfeinhalb Jahren zunehmend mit Deutschland und dessen Migrationspolitik haderte und Anzeichen von Verfolgungswahn zeigte. Im Jahr 2019 war von diesen Entwicklungen allerdings noch nichts zu merken.
Taleb A. wuchs in Saudi-Arabien auf und entschied sich mit Anfang zwanzig, den Islam zu verlassen. In einem Land, in dem auf die Abkehr vom Glauben die Todesstrafe steht, gelang es ihm, dieser Strafe zu entgehen, indem er bei Begegnungen mit Fremden oder entfernten Bekannten den Anschein eines praktizierenden Muslims aufrechterhielt.
Während sein engster Freundeskreis und viele seiner Verwandten von seinem Unglauben wussten, erfuhr seine Mutter erst davon, als er seinen Twitter-Account eröffnete und damit öffentlich wurde, so A. in der FAZ. Jetzt, so berichtet er, hasst ihn seine Familie dafür, dass er bestimmte religiöse Praktiken nicht akzeptieren könne.
Im Jahr 2006 kam Taleb A. nach Deutschland, um seine Facharztausbildung fortzusetzen. Erst nach zehn Jahren stellte er als Psychiater einen Asylantrag. Grund dafür waren Drohungen, die er erhielt, nachdem er in einem Internetforum des saudischen Aktivisten Raif Badawi islamkritische Beiträge veröffentlicht hatte. Die Drohungen waren so konkret, dass eine Rückkehr nach Saudi-Arabien keine Option mehr war.
Todesfahrer von Magdeburg sprach von saudischen Spionen
„Man wollte mich ,schlachten‘, wenn ich nach Saudi-Arabien zurückkehren würde. Also habe ich mich dazu entschieden, Asyl in Deutschland zu beantragen“, so A. in der FAZ. „Es hätte keinen Sinn ergeben, sich dem Risiko auszusetzen, doch zurückkehren zu müssen und dann getötet zu werden.“
Nachdem sein Asylantrag bewilligt wurde, nutzte Taleb A. die Gelegenheit, erstmals unter seinem vollen Namen öffentlich über seine Abkehr vom Islam zu sprechen. In den Jahren zuvor fiel es ihm selbst in Deutschland schwer, über seinen Unglauben zu reden, besonders in einem Arbeitsumfeld, das oft von muslimischen Kollegen aus Pakistan oder Indien geprägt war.
Er bemerkte, dass Menschen mit islamischem Hintergrund, die ihren Glauben ablegen, weder Verständnis noch Toleranz erfahren. Diese Erfahrung setzte sich auch bei seinen ehrenamtlichen Tätigkeiten für muslimische Asylbewerber fort, die ihn oft als schlechten Menschen betrachteten.
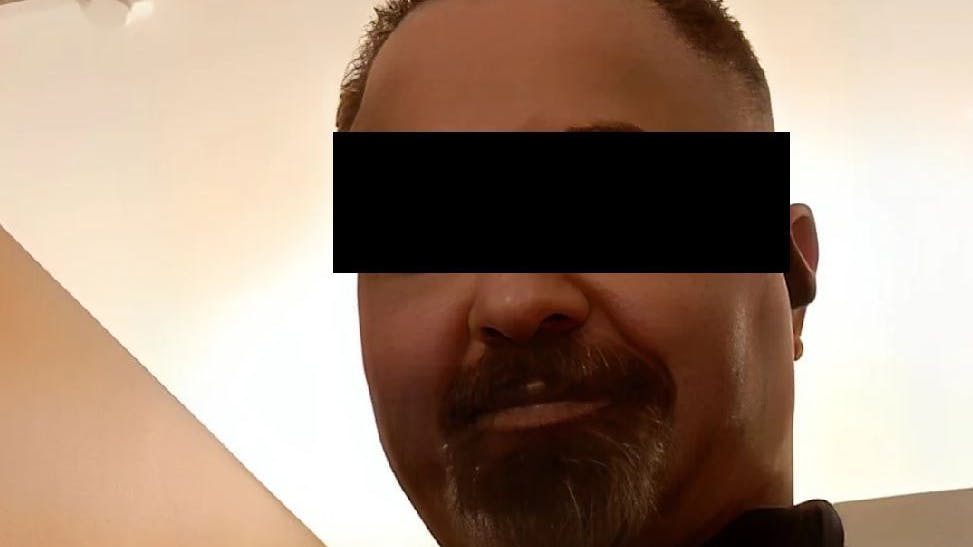
Durch die Eröffnung eines Twitter-Accounts begann Taleb A., andere saudische Männer und Frauen zu unterstützen, die aus ihrer Heimat vor Gewalt und Unterdrückung fliehen wollten. Ursprünglich hatte er nur die Absicht, den Islam zu kritisieren, doch schon kurz nach seiner Anmeldung kontaktierte ihn eine saudische Frau mit der Bitte um Hilfe bei ihrem Asylantrag. Daraus entwickelte sich eine intensive Unterstützungsarbeit, die später in der Gründung einer Telegram-Chatgruppe und des Online-Forums „We are Saudis“ mündete.
Seine islamkritische Haltung behielt Taleb A. bei und bezeichnet sich selbst als den aggressivsten Kritiker des Islams in der Geschichte. Sein Ziel sei es, die Menschen dazu zu bringen, eigenständig zu denken und Entscheidungen nicht aus blinder Gefolgschaft zu treffen. Er lehnt es ab, dass jemand den Islam nur aufgrund seiner Aussagen verlässt, sondern betont, dass dies eine persönliche Überzeugung sein müsse.
Die wirre Gedankenwelt des Todesfahrers von Magdeburg
Die Scharia, das islamische Recht, dominiert das Leben in Saudi-Arabien und ist fest in der Verfassung verankert. Taleb A. beschreibt im Interview erschreckende Zustände, in denen Verbrechen wie Ehrenmorde kaum geahndet werden und Väter oder Brüder oft straffrei davonkommen, wenn sie ihre Töchter oder Schwestern töten oder missbrauchen. Die Rechtslage sei zwar eindeutig, aber die tatsächliche Anwendung des Gesetzes sei von patriarchalen Strukturen durchzogen.
Frauen in Saudi-Arabien leben je nach Region unter sehr unterschiedlichen Bedingungen. Während in schiitischen Dörfern Frauen oft ein gewisses Sozialleben führen können, sieht es in sunnitischen Regionen oft anders aus. In städtischen Gebieten sind Frauen ebenfalls starken Einschränkungen unterworfen, insbesondere wenn ihre Familie konservativ eingestellt ist.
Der Fall der jungen Rahaf Mohammed, die 2019 auf ihrer Flucht in Bangkok festgehalten wurde, verdeutlicht die Schwierigkeiten, denen saudische Frauen bei der Flucht ausgesetzt sind. Taleb A. weist im FAZ-Interview darauf hin, dass Frauen in Saudi-Arabien grundsätzlich der Vormundschaft eines männlichen Verwandten unterstehen, der ihre Ausreise genehmigen muss.
Einige Frauen schaffen es trotzdem, ihre Ausreise zu organisieren, oft mit Taleb A.s Hilfe. Australien war lange ein bevorzugtes Ziel, weil das Asylverfahren dort unkompliziert war. Inzwischen beantragen viele Frauen Asyl auch in anderen Ländern wie Deutschland, Kanada oder Schweden.

Der Fall von Dina Ali Lasloom, die während eines Fluchtversuchs in Manila gestoppt und zurück nach Saudi-Arabien gebracht wurde, bleibt ein besonders tragisches Beispiel. Taleb A. hatte noch Kontakt zu ihr, bevor sie entführt wurde. Trotz aller Bemühungen konnte ihre Rückführung nicht verhindert werden, und seit ihrer Inhaftierung fehlt jede Spur von ihr.
A. ist sich bewusst, dass viele Frauen Angst haben, ihm zu vertrauen, und ermutigt dieses Misstrauen sogar, da viele saudi-arabische Spione aktiv seien. Trotzdem bleibt seine Plattform „We are Saudis“ für viele eine wichtige Informationsquelle, auch wenn die Website in Saudi-Arabien blockiert wurde.
Abschließend äußert Taleb A. Skepsis gegenüber der Forderung einiger Aktivisten, Frauen sollten im Land bleiben und dort für ihre Rechte kämpfen. Trotz einiger Reformen bleibe die Angst vor Repression allgegenwärtig, und viele Frauen sehen in der Flucht die einzige Möglichkeit, Freiheit zu erlangen.