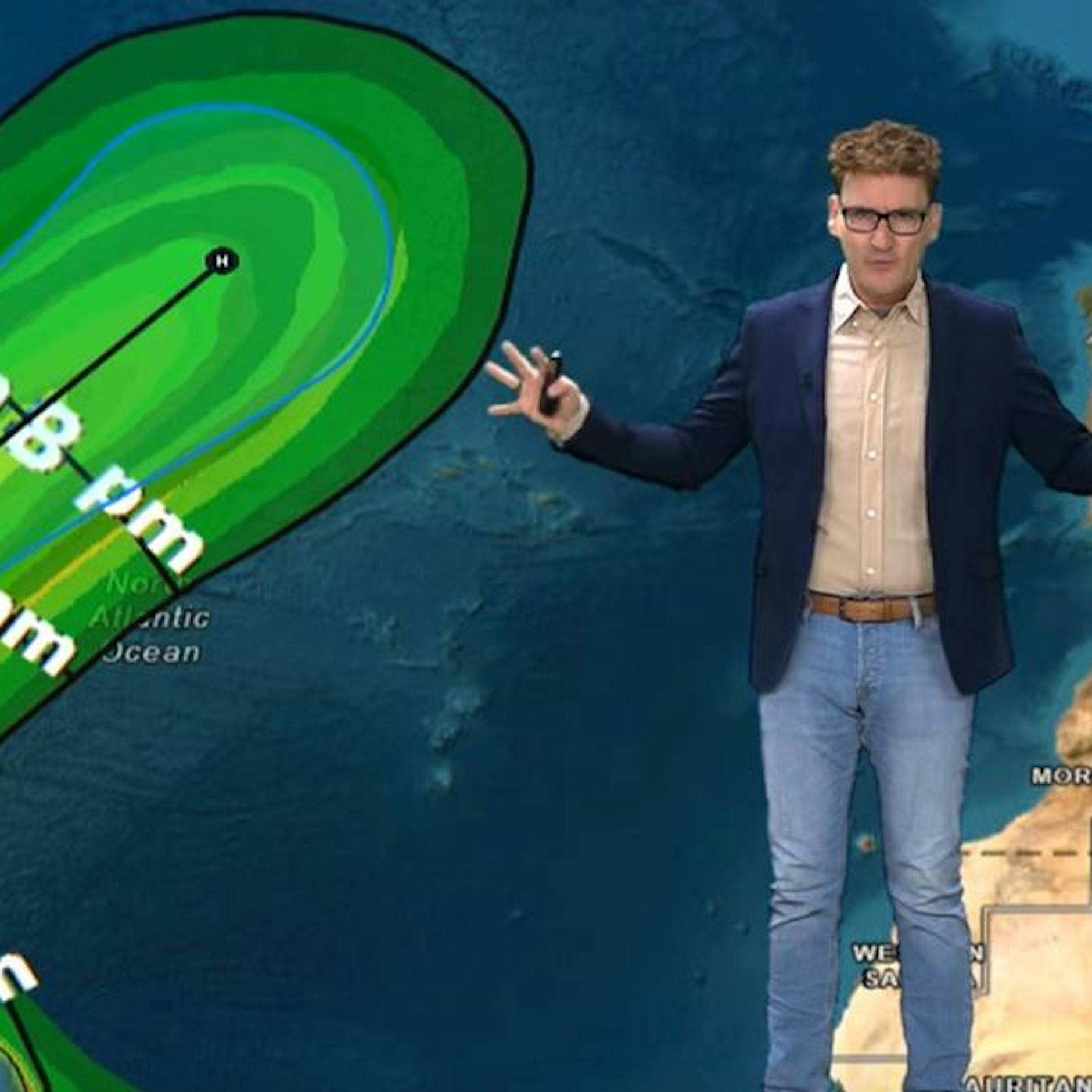Am 7. Oktober wäre die DDR 75 Jahre alt geworden. Würde es diesen Staat noch geben, hätten die Machthaber diesen Jahrestag mit großem Pomp gefeiert. Doch die Geschichte verlief anders. Im Herbst 1989 mussten Erich Honecker und Co. abdanken – dank der friedlichen Revolution des Volkes. Mit dem Mauerfall am 9. November 1989 war das Ende der DDR besiegelt.
Nun, 35 Jahre später, sieht die Lage im Land ganz anders aus. Die Stimmung der Ostdeutschen hat sich drastisch gewandelt. Auch wenn keiner eine große Jubelfeier zum 75. Geburtstag der DDR veranstalten wird, trauert man dem untergegangenem SED-Staat hinterher. Eine Studie der Uni-Leipzig zeigt erschreckend auf: Zwei Drittel der insgesamt 3.500 befragten Ostdeutschen gaben in einer Umfrage an, sich wieder nach der DDR zu sehnen.
Ist das die Sehnsucht nach Machthabern wie Erich Honecker? Spielt Ostalgie eine Rolle? Oder ist es die Wut darüber, dass im wiedervereinten Deutschland noch immer nicht die Leistungen der Ostdeutschen anerkannt wird?
Zu Letzterem zählen dürften auch solche Umstände, dass ausgerechnet am 7. Oktober 2024, dem Tag der DDR-Gründung, im Osten Berlins erneut ein Relikt der DDR abgerissen wird – das Jahnstadion. Und mit dem Sport- und Erholungszentrum steht ein weiterer Abriss eines ostdeutschen Kultbaus bevor.
DDR-Gründung vor 75 Jahren: Kein Grund zum Feiern
Wie gesagt, den 75. DDR-Geburtstag fällt aus. Anders als das 75. Jubiläum der Bundesrepublik im Mai dürfte der Jahrestag der DDR-Gründung 1949 sang- und klanglos übergangen werden. Erinnert wird stattdessen an den Triumph der friedlichen Revolution vor 35 Jahren und an den Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober.

Anna Kaminsky, Direktorin der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, findet das richtig: „Warum sollte man die staatliche Etablierung einer Diktatur feiern?“ Und doch sagt sie, es sei wichtig, an die historischen Hintergründe zu erinnern.
Denn die Gründung des zweiten deutschen Nachkriegsstaats besiegelte mehr als 40 Jahre deutsche Teilung – eine Erfahrung, die Millionen Menschen bis heute mit sich tragen. Sie prägte eine Sicht auf die Sowjetunion, auf Russland, auf die USA und die Nato, die die Deutschen in Ost und West oft bis heute entzweit.
„Natürlich wirkt die DDR nach mit dem, wie sie die Menschen geprägt hat und auch mit den Erwartungen an staatliche Institutionen, an staatliches Handeln und an die Demokratie“, sagt Kaminsky. Und offenbar beurteilen daher viele den verblichenen SED-Staat im Rückblick erstaunlich milde, wie die Studie der Uni Leipzig zeigt.
Man darf nicht vergessen, warum vor 75 Jahren die DDR gegründet wurde
Man darf nicht vergessen, warum die DDR am 7. Oktober 1949 gegründet wurde, nachdem sich die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs überworfen und die Besatzungszonen auseinander entwickelt hatten. Die Einführung der D-Mark in der britischen, französischen und amerikanischen Zone im Westen 1948 verschärfte die Spannungen. Nach Gründung der Bundesrepublik mit Verkündung des Grundgesetzes im Mai 1949 sah sich die Sowjetunion unter Druck, in ihrer Besatzungszone mit der Gründung des zweiten deutschen Staates nachzuziehen.
Immer wieder wurde gestritten, ob die Spaltung Deutschlands zu verhindern gewesen wäre. Ob die Regierung der Bundesrepublik Angebote der Sowjetunion hätte annehmen sollen. Der Historiker Wolfgang Benz kam in einer detaillierten Analyse schon vor Jahrzehnten zu dem Schluss: „Die Teilung Deutschlands war offenbar unvermeidbar gewesen.“
Das sieht Kaminsky genauso. „Das war überhaupt nicht zu verhindern“, sagt die in Gera geborene Sozialwissenschaftlerin. „Die Sowjetunion beharrte ja darauf, dass ganz Deutschland unter ihren Bedingungen existieren sollte. Also das heißt: keine Demokratie, keine freien Wahlen, keine Freiheitsrechte.“ Die unterschiedlichen politischen Systeme seien 1949 längst installiert gewesen. „Für die Ostdeutschen bedeutete dies vier weitere Jahrzehnte der Diktatur“, sagt Kaminsky.
Trotz Mauer und Diktatur: Ostdeutsche haben aber auch nicht die guten Seiten der DDR vergessen
Die DDR wurde ein Land, in dem am 17. Juni 1953 Hunderttausende für mehr Freiheit auf die Straßen gingen und von Panzern brutal gestoppt wurden. Aus dem bis 1990 rund 3,8 Millionen Menschen flüchteten. Das sich mit einer Mauer abschottete. Und das über die Jahre mehr als 600.000 Leute im Dienste der Staatssicherheit zur Überwachung der eigenen Bevölkerung einsetzte. Bis zu 250.000 Menschen saßen Schätzungen zufolge zeitweise aus politischen Gründen in Haft.

Das haben viele Ostdeutsche nicht vergessen. Die Älteren unter ihnen erinnern sich aber auch heute daran, dass die DDR ein Land war, in dem Menschen Familien gründeten, arbeiteten, zur Schule und zur Arbeit gingen, in Seen sprangen, an der Ostsee in der Sonne lagen.
Es war das Land von Jugendweihe und Betriebssportgemeinschaft, von Multifunktionstisch und Plattenbauwohnung, von Tempolinsen und Makrelenmix in Büchsen, von Pittiplatsch und Fernsehballett. Ein Land mit einem eigenen Universum an Waren, Geschmacksnoten und Gerüchen, an Regeln und Gepflogenheiten, an Alltag und Erinnerungen. Ein Land, das plötzlich weg war.
DDR war ein Land mit eigenem Universum
Oft sind nur noch die Erinnerungen geblieben. Und vielleicht sind diese ein Grund, weshalb über eine halbe Million Menschen jedes Jahr ins Berliner DDR-Museum gehen, das gerade das praktische Handbuch „DDR-Führer – Reise in einen vergangenen Staat“ neu aufgelegt hat. Beflügelt das Museum die Ostalgie? „Gar nicht“, sagt Stefan Wolle, wissenschaftlicher Leiter des Hauses. „Wir lehnen das ab.“
Einige Besucher hätten natürlich nostalgische Gefühle, nach dem Motto: „Ach guck mal, das Kochgeschirr, das hatte unsere Oma auch.“ Aber das sei nicht das Ziel. „Wir haben sogar viele Beschwerden, dass wir die ,schöne DDR‘ so ironisch darstellen und so ,schlecht machen‘.“

Wolle sagt, den verklärenden Blick auf den untergegangenen Staat könne er nicht richtig ernst nehmen. „Ja, vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren war alles viel schöner“, sagt der 73 Jahre alte Historiker, geboren in Halle an der Saale. „Das stimmt. Ich war 40 Jahre jünger und hatte das Leben vor mir.“
Noch einmal eine Woche DDR in der DDR leben – mit Anstehen und Stasi-Bespitzelung
Aber wer sich nach der DDR zurücksehne, solle sich vorstellen, noch einmal eine Woche in der DDR zu leben: „Dass sie beim Bäcker anstehen, beim Fleisch anstehen, und Gemüse im Konsum gibt es sowieso nicht mehr. Man bekommt kein Baumaterial, man bekommt kein Auto, man bekommt kein Telefon. Dazu die Parteiversammlungen, die Beobachtung durch die Stasi, die vorgeschriebenen Demonstrationen und Festumzüge, die Verlogenheit der öffentlichen Medien. Nach einer Woche hätten wir wieder Revolution“, sagt Wolle.

Der Jubelfeier vom 7. Oktober 1989 hat sich Wolle übrigens entzogen, jenem 40. DDR-Geburtstag mit der pompösen Parade auf der Karl-Marx-Allee, die dann auch die letzte sein sollte. „Wir haben damals zu jedem 7. des Monats eine Demonstration auf dem Alexanderplatz gemacht, als Protest gegen die Wahlfälschung am 7. Mai“, sagt der Historiker, spielt damit auf die Unregelmäßigkeiten der DDR-Kommunalwahl 1989 an.