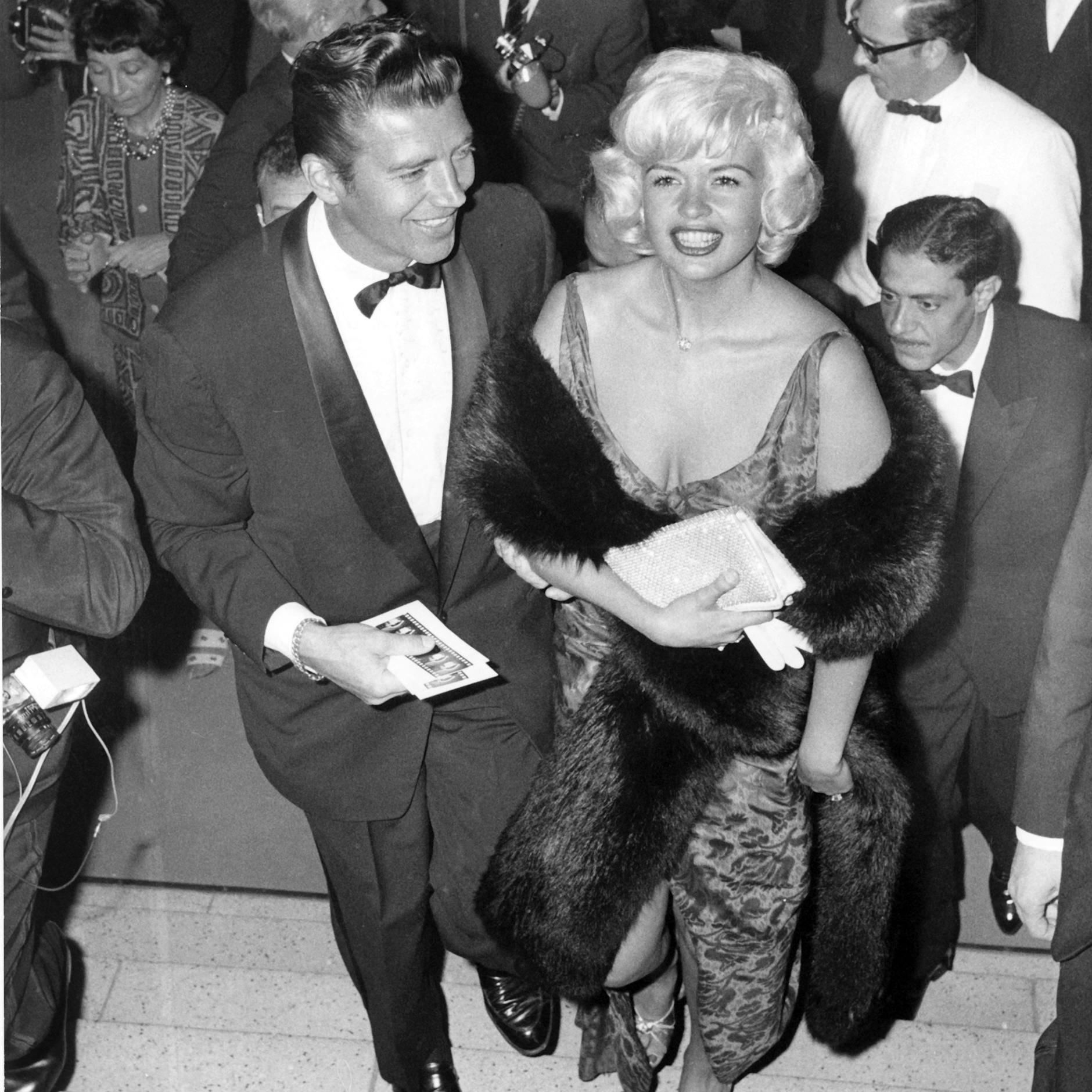„Das mit der Faust auf den Tisch Schlagen nimmt ab, wenn er gedeckt ist“, sagte der Schriftsteller Peter Maiwald. Einen ähnlichen Gedanken hatte Frank Jeromin Ende der 1980er Jahre, damals Referent der Geschäftsführung bei Mosaik, der sich um Menschen mit Behinderung kümmert. Jeromin wollte einen Ort schaffen, der Menschen zusammenbringt, mit und ohne Behinderung, Groß und Klein, Jung und Alt. So entstand das Restaurant Charlottchen, einer der ersten Inklusionsbetriebe Berlins.
Am Donnerstag feiert das Charlottchen, das zudem auch noch Berlins erstes Kinderrestaurant war, sein 35-jähriges Bestehen. Die Eröffnung 1990 war eine totale Neuheit – und sie war der Grundstein für das heutige Inklusionsunternehmen dahinter, die Mosaik-Services GmbH. Menschen mit Behinderung ganz normal im ersten Arbeitsmarkt und nach Tarif einstellen? Das gab es bis dahin nicht.
Behinderte sollten höchstens in Werkstätten arbeiten
Heute arbeiten nicht nur im Charlottchen, sondern auch im Café Schwartzsche Villa in Steglitz, im Café Jagdschloss Grunewald in Wilmersdorf oder in der Kantine im Konzerthaus Menschen mit Behinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt zu tariflichen Bedingungen. Auch im Humboldtforum betreibt die Lebenswelten Restaurations GmbH nach ähnlichen Prinzipien inklusive Cafés und Bistros. Auch in der Schankhalle am Pfefferberg und in vielen weiteren Inklusionsfirmen arbeiten Behinderte mit Nichtbehinderten zusammen.
Wenn er sich an die Anfänge des ersten Inklusionsbetriebs erinnert, beschreibt Frank Jeromin einen wenig fortschrittlichen Zustand: „Die Inklusionsdebatte befand sich damals noch in einer Art Dornröschenschlaf. Menschen mit Behinderung sollten bestenfalls in Werkstätten arbeiten, eine Anstellung im sogenannten ersten Arbeitsmarkt war für viele Leute utopisch und es galt sogar als ungesetzlich.“

Heute arbeiten Menschen mit Behinderung ganz selbstverständlich in Küche und Service des Charlottchen. Es gibt Familien, da gehen mittlerweile die Großeltern mit ihren Enkeln in das Restaurant. Schon mit ihren Kindern waren sie da.
Bloß keine Pommes und Spaghetti im Kinderrestaurant
Aus der ehemaligen Eckkneipe Nante in der Nähe des S-Bahnhofs Charlottenburg wurde eine Inklusions-Institution, doch zunächst mit Hindernissen: „Wir hatten vor der Eröffnung in der Nachbarschaft gefragt, was denn so auf die Karte für ein Restaurant dieser Art sollte. Das Feedback war eindeutig. Viel Bio, viel Vollkorn, frisches Gemüse. Bloß keine Pommes und Spaghetti. Genau so sind wir dann auch gestartet, aber es lief schlecht, wir mussten viel Essen wegwerfen.“
Die Mauer war gerade erst gefallen, die Charlottenburger gingen lieber in Ost-Berlin essen. Mit 1:7 getauschter DDR-Mark konnte man günstig Restaurants besuchen. Der zweite Grund für den miesen Start waren die fehlenden Pommes und Spaghetti auf der Karte. Als man das erkannt hatte, lief der Laden und auch die Familien mit ihren Kindern kamen – bis heute.
Kerstin Hallensleben arbeitet seit 20 Jahren in der Mosaik-Gastronomie und sie liebt ihren Arbeitsplatz: „Es macht einfach Spaß, den Gästen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und ihnen eine gute Zeit zu bereiten“, sagt sie. „Ich habe 2000 in einer Werkstatt angefangen, seit 2004 bin ich in der Gastronomie. Hier bin ich angekommen. Die Kollegen sind nett, verlässlich und wir helfen uns gegenseitig – das ist das wichtigste, denke ich. Ich fühle mich rundum wohl und komme jeden Tag gerne zur Arbeit. Manchmal müssen mich meine Vorgesetzten schon fast rauswerfen, damit ich nicht zu lange bleibe.“ Die Arbeit gebe ihr Halt, sagt Kerstin Hallensleben. „Ich kann jeden Tag beweisen, dass ich selbstständig mein Leben gestalten und auch finanzieren kann. Und ich kann die Gerichte aus unserem Restaurant zu Hause nachkochen, das finde ich toll.“

Neben dem Restaurant Charlottchen betreibt Mosaik-Services weitere Firmen, in denen Menschen mit und ohne Behinderung zusammen arbeiten. Dass dieses Konzept schnell Erfolg haben würde, hat Frank Jeromin überrascht. „Mitte der 90er kamen ja schon die weiteren Betriebe und Auszubildenden dazu. Das zeigt, dass die Idee richtig war. In den letzten 35 Jahren konnten wir eine dreistellige Zahl an Menschen mit Behinderung in eine tarifliche Arbeit bringen.“ Nicht nur in den eigenen Betrieben, sondern auch in der wirklich freien Wirtschaft sind spätestens seit dem Fachkräftemangel gut geschulte Mitarbeiter gefragt.
Antrag auf Anerkennung einer Schwerbehinderung dauert ein Jahr
„Dass Inklusion funktioniert, ist ein Fakt“, sagt Frank Jeromin. „Die Nachfrage ist da, wir könnten unsere Kapazitäten sogar verdoppeln – besonders bei der Gebäudereinigung.“ Menschen mit Behinderungen in eine tarifliche Arbeit zu bringen, sei jedoch immer ein kleines Kunststück. „Nicht wegen der Fähigkeiten der Mitarbeiter, sondern weil der bürokratische Aufwand extrem hoch ist.“ Die Bearbeitung eines Antrags auf Anerkennung einer Schwerbehinderung dauere inzwischen über zwölf Monate!
Weniger Bürokratie, einfachere Vorgänge, damit wäre schon viel gewonnen. Den ständigen Balanceakt zwischen Wirtschaftlichkeit und der professionellen Begleitung von Menschen mit Behinderung bekommen sie dann schon hin, ist Jeromin optimistisch.
„Was die Arbeit für uns bedeutet, ist für Außenstehende oft nicht zu erkennen“, sagt Kerstin Hallensleben: „Hier können wir uns einbringen, ein Teil des Ganzen sein. Und darum sollte es doch überall gehen: Teamarbeit und sich gegenseitig helfen, um ein Ziel zu erreichen. Nur zusammen funktioniert es.“ ■