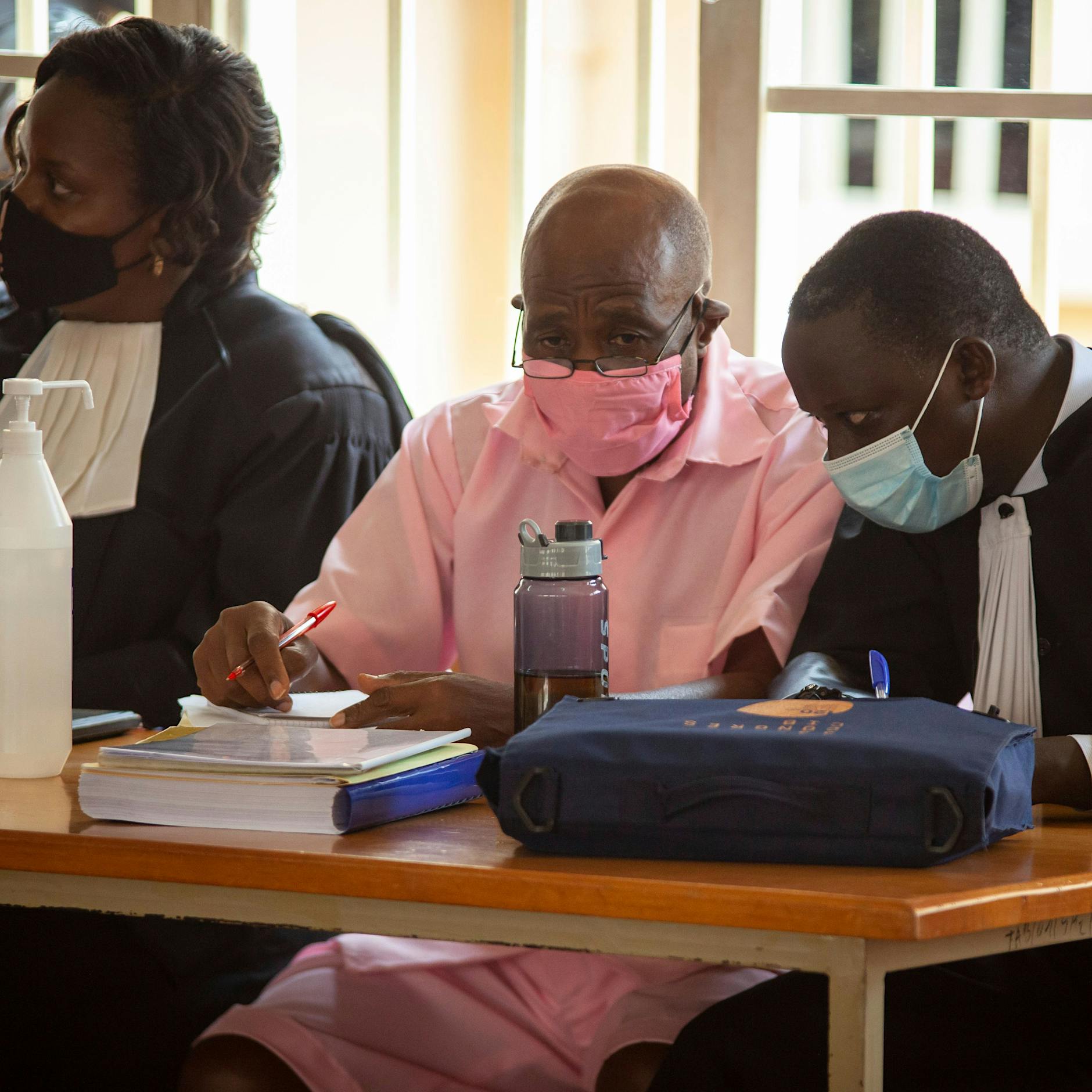Alles begann mit einem Briefumschlag aus dem Jahr 1940. Mit roter Farbe ist darauf gestempelt: „Empfänger im Getto nicht auffindbar“. Ralph Ide fand ihn in einer Akte, in der Zweigstelle der Sparkasse in Falkenstein im Vogtland, in der er damals arbeitete. „Ich forschte weiter. Nicht wissend, was sich daraus entwickeln würde“, erzählt er. Ide stieß auf die Geschichte der jüdischen Bevölkerung der Stadt, nahm Kontakt zu Nachfahren auf, befragte Zeitzeugen vor Ort. Es dauerte nicht lange, bis dabei der Name Alfred Roßner (1906–1943) fiel.
„Ich erfuhr von einem Falkensteiner Bürger, der viele Juden während der Nazi-Zeit gerettet haben soll“, sagt Ide heute. Überlebende des Holocaust stießen für diesen Mann sogar eine Ehrung an: 1995 erhielt Roßner posthum den Titel „Gerechter unter den Völkern“ der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. „Hier in Falkenstein wiederum war das lange fast unbekannt. Vieles lag im Verborgenen. Auch heute hätten seine Taten mehr Aufmerksamkeit verdient.“
Ide, der inzwischen im Stadtarchiv in Falkenstein arbeitet, fing an, sich mit noch lebenden Verwandten Roßners im Vogtland zu treffen. Und er schrieb und telefonierte über die Jahre mit Betroffenen des Holocaust, die inzwischen in verschiedenen Ländern lebten. „Sie waren schon damals älter. Mittlerweile sind viele von ihnen gestorben und ich bin froh, dass ich ihre Erinnerungen retten konnte.“

Alfred Roßner rettete jüdische Fabrikarbeiter
Alfred Roßner wuchs in Falkenstein auf, ging dort zur Schule. In jungen Jahren freundete er sich mit den Kindern der jüdischen Familie Verleger an. 1938 wurde sie im Rahmen der sogenannten Polenaktion mit Tausenden anderen aus Deutschland ausgewiesen. Aber der Kontakt zwischen Roßner und seinen jüdischen Freunden brach nicht ab. Als die Verlegers nach Beginn des Zweiten Weltkriegs ihre Textilfirma im polnischen Będzin durch Enteignung verloren, wandte sich Ariel Verleger als Sohn des Hauses an seinen deutschen Freund. „Roßner wurde als Treuhänder der Firma eingesetzt“, erläutert Ide. „Anfangs aus geschäftlichen Interessen gedacht, stand bald die Rettung von Juden im Vordergrund.“
Die Fabrik stellte Wehrmachtsuniformen her, galt als kriegswichtig. „Durch Sonderberechtigungen versuchte Roßner, die jüdischen Fabrikarbeiter vor der Deportation in die Vernichtungslager zu schützen“, erklärt Ide. Zusätzlich habe er geheime Verstecke für sie bauen lassen und einigen ermöglicht, mit gefälschten Papieren aus Będzin zu fliehen. So konnte die Jüdin Lene Goldstein nach Falkenstein zurückkehren. „Sie färbte sich die Haare blond und überlebte, weil sie sich bei Roßners Verwandten bis Kriegsende verstecken konnte.“

Roßner selbst fuhr auch in das Ghetto von Będzin, um Juden herauszuschmuggeln – versteckt in einem Lastwagen voller Kleidung. Im Grunde sei er wie Oskar Schindler gewesen, konstatiert Ide. Schindler hat rund 1200 jüdische Zwangsarbeiter vor der Ermordung bewahrt – 1993 setzte ihm der Regisseur Steven Spielberg mit dem preisgekrönten Film „Schindlers Liste“ ein filmisches Denkmal.
Für Roßner ging das Ganze allerdings nicht gut aus. Die Gestapo erfuhr von seinen Aktivitäten und verhaftete ihn. Er starb im Dezember 1943 im Gefängnis im heutigen Sosnowiec. Die genauen Umstände seines Todes sind unklar. Wie viele Juden durch Alfred Roßner gerettet wurden, ist nicht überliefert. „Aber die es geschafft hatten, waren ihm bis zu ihrem Lebensende dankbar“, erklärt Ide.
Es sei eine Pflicht, die Erinnerung an diesen besonderen Menschen wachzuhalten, betont Marco Siegemund (CDU), Bürgermeister von Falkenstein. „Das sind wir allen Opfern von damals schuldig, auch Roßner selbst. Er ist ohne Zweifel eine Ausnahmeerscheinung in der Geschichte der Stadt Falkenstein und des gesamten Vogtlandes.“
Die Welt sei aktuell in einer tiefen Unordnung und in Turbulenzen geraten, konstatiert Siegemund. „Wir spüren in der Gesellschaft verstärkt Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt gegenüber Andersdenkenden. Hier ist große Wachsamkeit gefragt.“ Deshalb verleiht die Stadt seit vorigem Jahr die Alfred-Roßner-Medaille. Damit werden Menschen geehrt, die sich für eine tolerante Zivilgesellschaft und ein friedvolles Miteinander engagieren.

Dem online verfügbaren Bericht der Gedenkstätte Yad Vashem über Alfred Roßner zufolge, der in englischer Sprache verfasst ist, bezeugten Überlebende seine Menschlichkeit, die ihn von anderen deutschen Unternehmenstreuhändern unterschied. Demnach warnte er die jüdische Bevölkerung von Będzin vor drohenden Deportationen und befreite einige im letzten Moment aus Transportzügen.