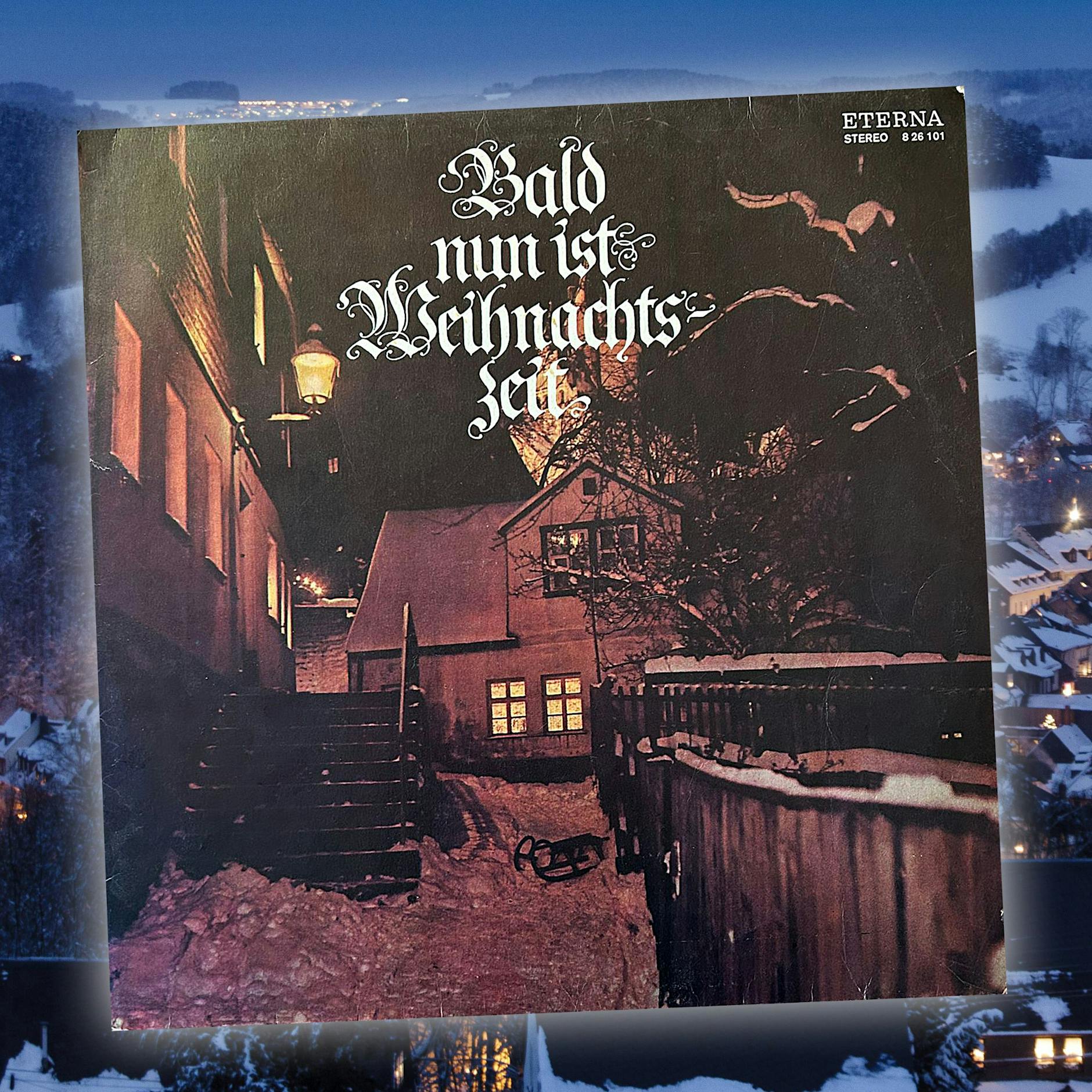Nicht mehr lange bis Heiligabend, bis wir uns in den Wohnstuben versammeln und vor dem festlich geschmückten Baum singen: „O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter …“ Aber halt, warum eigentlich „Blätter“ und nicht „Nadeln“?
Das bekannte Weihnachtslied, das dem Christbaum gewidmet ist, geht auf ein Lied aus dem 16. Jahrhundert zurück. Der Text, so wie wir ihn kennen, kam allerdings erst im 19. Jahrhundert dazu. Gleich zwei Dichter waren dabei am Werk. Die erste Strophe schrieb der Theologe und Pädagoge Joachim August Zarnack 1819, die zweite und dritte Strophe der Lehrer und Komponist Ernst Anschütz fünf Jahre später.
Warum sind bei „O Tannenbaum“ die Blätter „treu“?

Bereits im 16. Jahrhundert wurde zu der Melodie von der Tanne gesungen, deren Zweige sommers wie winters grün sind. Joachim August Zarnack (1777–1827) machte daraus ein tragisches Liebeslied, in dem ein junger Mann die untreue Geliebte beklagt, die nur an sonnigen Tagen zu ihm hält und nicht in schweren Zeiten. So hieß es bei ihm auch „O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter“ (die immergrüne Tanne symbolisiert die ewige Treue), und in seiner zweiten Strophe wird gesungen „O Mägdelein, o Mägdelein, wie falsch ist dein Gemüte“.
Als sich der Leipziger Lehrer Ernst Anschütz (1780–1861) das Lied vornahm, behielt er die erste Strophe von Zarnack bei, ersetzte die restlichen aber mit weiteren Hymnen an den Tannenbaum – „dein Kleid will mich was lehren:/Die Hoffnung und Beständigkeit/gibt Trost und Kraft zu jeder Zeit.“ Zu dieser Zeit erstrahlte in immer mehr Bürgerstuben eine festlich geschmückte Tanne zu Weihnachten – so wurde aus dem Liebeskummer-Lied das Weihnachtslied.
Warum Blätter statt Nadeln bei „O Tannenbaum“?
Von Blättern zu singen, hört sich beim Tannenbaum falsch an. Doch als der Liedtext Anfang des 19. Jahrhunderts entstand, war es durchaus noch üblich von Blättern bei Tannen zu sprechen. Und falsch ist es auch nicht. Botanisch gesehen sind Tannennadeln Blätter, nur eben mit einer sehr, sehr schmalen Blattfläche. Die Funktion der Nadel ist die eines Blattes, die Nadeln der Tannen betreiben ebenso Fotosynthese wie die Blätter anderer Bäume.
Warum ist der Weihnachtsbaum eine Tanne?
Seinen Ursprung hat der Weihnachtsbaum übrigens im Mittelalter. Damals wurde an Weihnachten in den Kirchen vor dem Krippenspiel das Paradiesspiel aufgeführt. Also die Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies als Schauspiel dargeboten. Als Paradiesbaum nahm man einen Tannenbaum, einfach weil der im Winter noch grün war. An die Zweige hängte man rote Äpfel. Die wiederum waren die Vorläufer der Christbaumkugeln.