
Ganze zehn Millionen neue Kredite wurden allein 2024 vergeben - nur an Privatpersonen. Insgesamt, so schreibt es die Statistik-Plattform Statista, befanden sich Ende 2023 1,5 Milliarden Kreditsumme für Privatpersonen, und weitere 1,87 Milliarden für Unternehmen im Umlauf.
Hinter jedem dieser Kredite steht mindestens ein Antragsteller. Wie teuer der Kredit im Rahmen allgemeingültiger Faktoren (etwa der Leitzinsen) wird, bestimmt nur sein persönliches finanzielles Standing. Damit steht auch fest: Wer sich für derartige (Fremd-)Finanzierungen mit anderen zusammentut, kann mitunter sehr stark profitieren.
Gemeinsam investieren: Kooperation statt Einzelkämpfertum
Kreditvergabe ist aus Sicht der Banken…
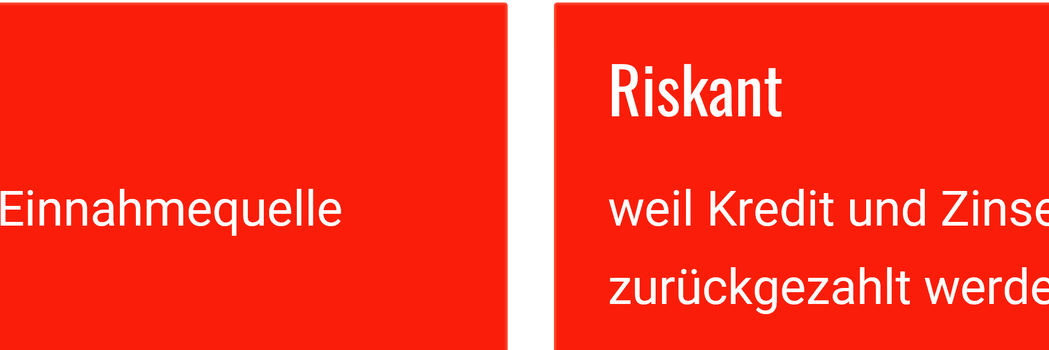
Kreditinstitute verfolgen daher eine zweigleisige Strategie:
Sie überprüfen jeden Antragsteller sorgfältig auf dessen Bonität und andere Risikofaktoren. Basierend auf den ermittelten Risiken gestalten sie dann den potenziellen Zinssatz und verlangen ggf. weitere Sicherheiten.
Allerdings wird dieses Prinzip in der heutigen Zeit immer komplexer. Denn Banken dürfen Risikofaktoren nicht nach eigenem Gutdünken festlegen. Nationale Gesetze sowie internationale Vereinbarungen verlangen immer schärfere Bonitätsprüfungen, geben strenge Risikobewertungsmuster vor und verlangen von den Instituten hohe Eigenkapitalreserven. Diese Sicherheitsmaßnahmen dienen dem Schutz aller Kunden innerhalb der Volkswirtschaft vor Ausfällen und potenziellen Insolvenzen im Bankenbereich.

In einer solchen Lage könnten sich mehrere Personen oder Partner zusammenschließen, um gemeinsam Kredite aufzunehmen.
Besonders häufig wird dieses Konzept in folgenden Varianten genutzt:
Private Kreditgemeinschaft (etwa Lebens- und Ehepartner, Freunde, Familien) Gesellschaftsbasierte Gemeinschaft (insb. GbR, GmbH und Genossenschaften)
Gemeinsam finanzieren: Das sind die ökonomischen Vorteile
Gemeinsames Finanzieren birgt verschiedene Vorteile, sowohl für Kreditnehmer als auch für Kreditgeber.
Das sind insbesondere die folgenden Punkte:

Das wohl bekannteste Beispiel für eine solche Kooperation ist das Ehepaar, das gemeinsam einen Kredit aufnimmt, um ein Haus zu kaufen. Tatsächlich können die Vorteile bei einem zweiten Kreditnehmer sehr stark sein. So wäre es beispielsweise für zwei Antragsteller mit je 50.000 Euro Jahreseinkommen deutlich einfacher und günstiger, einen gemeinsamen Kredit über 500.000 Euro zu erhalten als zwei Einzelkredite zu 250.000 Euro.

So kann ein zweiter Kreditnehmer alles verändern:
<div style="min-height:370px" id="datawrapper-vis-6pwUY"><script type="text/javascript" defer src="https://datawrap p er.dwcdn.net/6pwUY/embed.js„ charset="utf-8“ data-target="#datawrapper-vis-6pwUY">
</script><noscript><img src=="https://datawrap p er.dwcdn.net/6pwUY/full.png„ alt="Die Grafik zeigt die durchschnittliche Veränderung der Annahmewahrscheinlichkeit mit einem zweiten Kreditnehmer im Zeitraum von April 2024 bis Juli 2025. Der Wert liegt zu Beginn bei rund 44 %, steigt im Verlauf auf etwa 60 % an und bewegt sich damit deutlich im positiven Bereich. Die Datenbasis sind über smava vermittelte Ratenkredite, ausgewertet nach einem vs. zwei Kreditnehmern.“ /></noscript></div>
Welche Modelle zur gemeinsamen Finanzierung gibt es?
Ganz grob lassen sich solche Herangehensweisen in private und unternehmerische Kooperationen aufschlüsseln. Innerhalb dieser Einteilung gibt es weitere Unterscheidungen, von denen wir die häufigsten näher betrachten möchten.

1. Ehe- bzw. Lebenspartner
Häufigster Fall:
Gemeinsamer Immobilienkauf.
Vorteil:
Gemeinsames Einkommen und Vermögen, enge zwischenmenschliche Bindung.
Risiko:
Trennung oder Scheidung - Kredit bleibt in dem Fall dennoch bestehen.
Lösung:
klare Regelungen zu Eigentumsanteilen, Tilgung, Absicherung.
Gemeinsamer Immobilienkauf.
Vorteil:
Gemeinsames Einkommen und Vermögen, enge zwischenmenschliche Bindung.
Risiko:
Trennung oder Scheidung - Kredit bleibt in dem Fall dennoch bestehen.
Lösung:
klare Regelungen zu Eigentumsanteilen, Tilgung, Absicherung.
2. Freunde oder Zweckgemeinschaften
Häufigster Fall:
Wohngemeinschaften, alternative Wohnprojekte, Co-Working-Immobilien - oft als GbR.
Vorteil:
Gemeinsames Einkommen und Vermögen, ähnliche Zielrichtung.
Risiko:
Streit, unterschiedliche (langfristige) Vorstellungen, unterschiedliche Bonitäten.
Lösung:
Schriftliche Vereinbarungen zu Haftung, Rückzahlung und Eigentumsverhältnissen.
3. Geschäftspartner oder Investorengruppen
Häufigster Fall:
Kapitalaufbringung für Unternehmensgründungen oder Expansionen.
Vorteil:
Verteilung des finanziellen Risikos, schnellere Kapitalbeschaffung.
Risiko:
Wirtschaftliche Schieflagen, strategische Kurswechsel, entstehende Konkurrenzsituationen.
Lösung:
Transparente Buchführung und klare Geschäftsordnung.
4. Genossenschaftliche und digitale Modelle
Häufigster Fall:
Bürgerenergieprojekte, gemeinschaftliche Wohnbaugesellschaften, genossenschaftliche Start-ups.
Vorteil:
Breite Kapitalbasis, demokratische Entscheidungsstrukturen, geringere Abhängigkeit von einzelnen Großinvestoren.
Risiko:
Geringe Einflussmöglichkeiten des Einzelnen, komplexe Verwaltungsstrukturen, Abhängigkeit von der Verlässlichkeit des Vorstands.
Lösung:
Transparente Satzungen und klare Kommunikationskanäle, regelmäßige Berichterstattung, rechtlich sauber geregelte Mitbestimmungsrechte.
Was sind die rechtlichen und organisatorischen Grundlagen?
Banken sind zwar in vergleichsweise weiten Grenzen dazu bereit, mehrere Partner zu akzeptieren. Allerdings können sie sich auch in solchen Konstellationen nicht von internen und externen Vorgaben lösen.
Diese Grundlagen sollten Kreditpartner kennen und im Kontakt mit der Bank und der Kreditgemeinschaft berücksichtigen:

